Description
Efnisyfirlit
- Vorwort
- I Problemstellung, Theorie- und Begriffsgeschichte
- Thomas Voss I.1 Von den britischen Klassikern zur Verhaltensökonomik: Eine kurze Geschichte der Rational-Choice-Theorie
- I.1.1 Einleitung
- I.1.2 Klassische britische Sozialtheorie: Thomas Hobbes, Schottische Moralphilosophie und Utilitarismus
- I.1.3 Ökonomische Neoklassik und Max Weber: Rationale Entscheidungen unter Sicherheit
- I.1.4 Theorien von Entscheidungen unter Risiko und Unsicherheit
- I.1.5 Rationalität in sozialen Interaktionen: Spieltheorie
- I.1.6 Eingeschränkte Rationalität und Verhaltensökonomik
- I.1.7 Ausblick: Rational-Choice-Soziologie
- Werner Raub I.2 Sozialwissenschaftliche Erklärungen als rationale Modelle
- I.2.1 Einleitung
- I.2.2 RCT-Erklärungen: Drei Vignetten
- I.2.3 Die Struktur von RCT-Erklärungen: Ein Mikro-Makro-Diagramm
- I.2.4 RCT-Erklärungen: Einige zentrale Gesichtspunkte
- I.2.5 Schluss
- Catherine Herfeld I.3 Spielarten der Rational-Choice-Theorie
- I.3.1 Einleitung
- I.3.2 Die verschiedenen Spielarten der Theorie rationalen Entscheidens
- I.3.3 Zusätzliche Varianten und Erweiterungen der RCT
- I.3.4 Schluss
- II Theoretische Grundlagen
- Andreas Tutić II.1 Entscheidungstheorie
- II.1.1 Einleitung
- II.1.2 Präferenzen
- II.1.3 Entscheidungen
- II.1.4 Ordinaler Nutzen
- II.1.5 Kardinaler Nutzen
- II.1.6 Methodologische Anmerkungen
- Heinrich H. Nax, Bary S. R. Pradelski II.2 Nichtkooperative Spieltheorie
- II.2.1 Ursprünge
- II.2.2 Spiele in Normalform
- II.2.3 Lösungsansätze
- II.2.4 Spiele in extensiver Form und Subspielperfektion
- II.2.5 Rational-Choice-Grundlagen
- II.2.6 Abschließende Bemerkungen
- Harald Wiese II.3 Kooperative Spieltheorie
- II.3.1 Kooperative Spiele und ihre Theorien
- II.3.2 Pareto-Effizienz
- II.3.3 Der Kern
- II.3.4 Die Shapley-Lösung: Algorithmus und Axiome
- II.3.5 Die Shapley-Lösung als Ergebnis balancierender Operationen
- II.3.6 Nichttransferierbarer Nutzen und Nash-Lösung
- II.3.7 Lösungen auf Partitionen
- II.3.8 Lösungen auf Netzwerke
- II.3.9 Endogenisierung von Netzwerken
- II.3.10 Rückblick: Nichtkooperative versus kooperative Spieltheorie
- Sascha Grehl II.4 Verhaltensökonomik und Begrenzte Rationalität
- II.4.1 Einleitung
- II.4.2 Empirische Befunde und theoretische Implikationen
- II.4.3 Alternative Modelle bei Entscheidungen unter Sicherheit
- II.4.4 Alternative Modelle bei Entscheidungen unter Unsicherheit
- II.4.5 Alternative Modelle der Spieltheorie
- II.4.6 Modellierungen von Präferenzen
- II.4.7 Schluss
- III Zentrale Anwendungsfelder und empirische Evidenzen
- Wojtek Przepiorka III.1 Soziale Dilemmas
- III.1.1 Einleitung
- III.1.2 Kooperation
- III.1.3 Koordination
- III.1.4 Konflikt
- III.1.5 Zusammenfassung
- Johanna Gereke, Heiko Rauhut III.2 Öffentliche Güter und kollektives Handeln
- III.2.1 Ursprung und Definition
- III.2.2 Experimentelle Kollektivgut-Studien
- III.2.3 Konditionale Kooperation
- III.2.4 Sanktionsmöglichkeiten: Altruistische Strafen
- III.2.5 Antisoziale Bestrafung
- III.2.6 Kommunikation
- III.2.7 Ausblick
- Vincenz Frey III.3 Vertrauen in sozialen Netzwerken
- III.3.1 Einleitung
- III.3.2 Das Vertrauensspiel
- III.3.3 Vertrauen in wiederholten Interaktionen
- III.3.4 Vertrauen in sozialen Netzwerken
- III.3.5 Vertrauen und soziale Einbettung im Labor
- III.3.6 Abschließende Bemerkungen
- Karl-Dieter Opp III.4 Normen und Institutionen: Entstehung, Wandel und Wirkungen. Eine Anwendung der Theorie rationalen Handelns
- III.4.1 Einführung
- III.4.2 Was versteht man unter Normen und Institutionen?
- III.4.3 Zur Messung von Normen
- III.4.4 Einige Eigenschaften von Normen
- III.4.5 Faktorenerklärungen und die Anwendung der Rational-Choice-Theorie
- III.4.6 Die Entstehung und der Wandel von Normen
- III.4.7 Die Wirkungen von Normen
- III.4.8 Dynamische Modelle
- III.4.9 Empirische Forschung
- III.4.10 Resümee
- Thomas Gautschi III.5 Austausch und Verhandlungen
- III.5.1 Einführung
- III.5.2 Netzwerktauschtheorie und die Soziologie
- III.5.3 Theorien zum Netzwerktausch
- III.5.4 Abschließende Bemerkungen
- IV Grenzen und aktuelle Entwicklungen
- Andreas Tutić IV.1 Anomalien der Rational-Choice-Theorie
- IV.1.1 Einleitung
- IV.1.2 Präferenz- und Nutzentheorie
- IV.1.3 Stochastik
- IV.1.4 Logik
- IV.1.5 Framing-Effekte
- IV.1.6 Iteratives Denken und Strategische Unsicherheit
- IV.1.7 Auszahlungseffekte
- IV.1.8 Schluss
- Hartmut Esser, Clemens Kroneberg IV.2 Das Modell der Frame-Selektion
- IV.2.1 Hintergründe
- IV.2.2 Frames, Skripte und die „Definition“ der Situation
- IV.2.3 Das Grundmodell
- IV.2.4 Varianten und ähnliche Ansätze
- IV.2.5 Befunde und Perspektiven
- Andreas Diekmann IV.3 Rational-Choice-Theorie. Heuristisches Potential, Anwendungen und Grenzen
- IV.3.1 Einleitung
- IV.3.2 Rational-Choice-Theorie
- IV.3.3 RCT und analytische Soziologie
- IV.3.4 RCT in Situationen strategischer Interaktion
- IV.3.5 Mikro-Makro-Erklärung
- IV.3.6 Anwendung der Rational-Choice-Theorie: Ein Leitfaden
- Herausgeber und Autoren
- Index

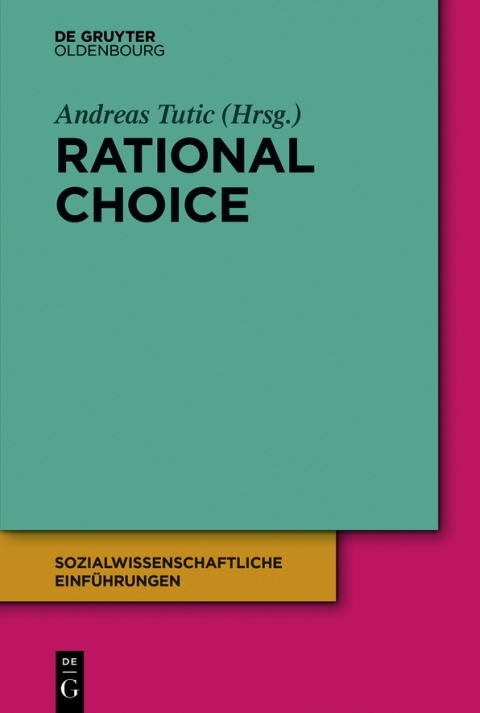
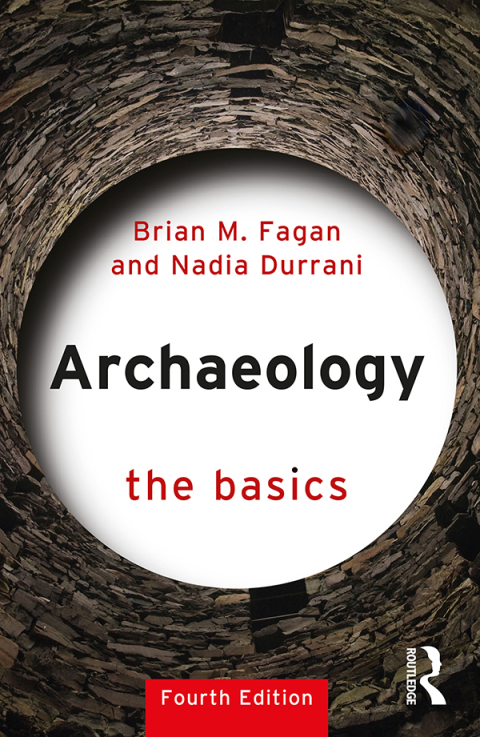
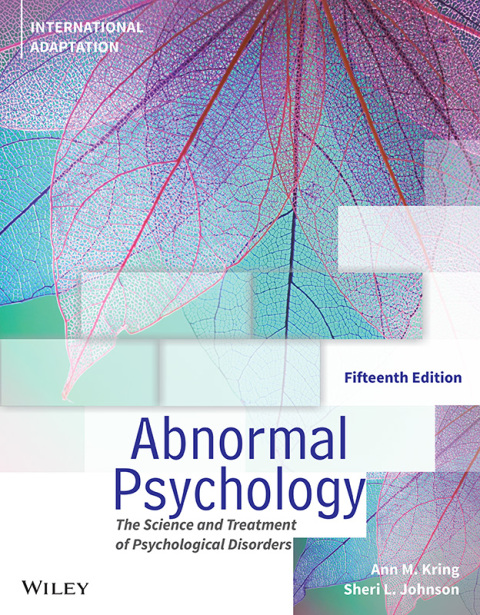
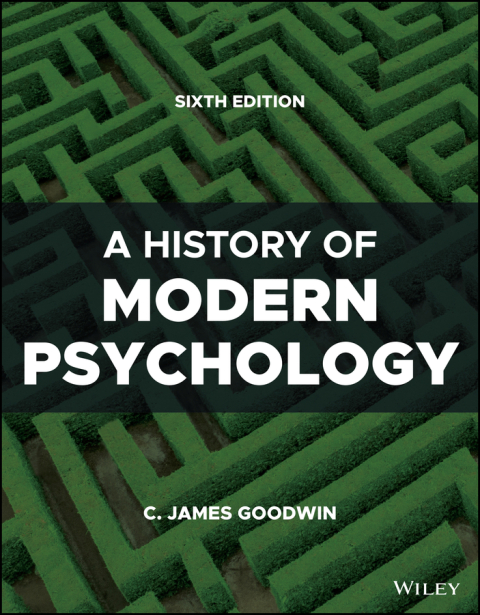
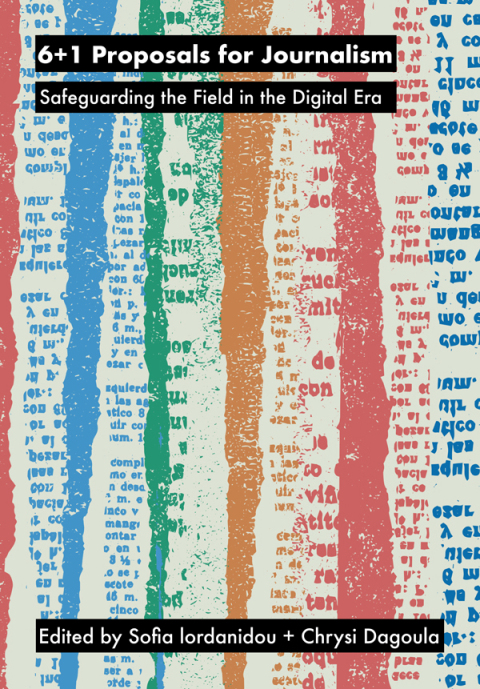
Reviews
There are no reviews yet.